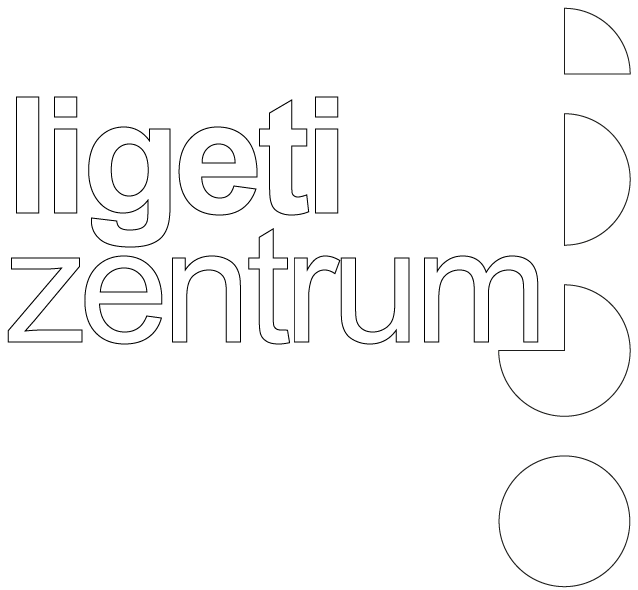- Diese Veranstaltung hat bereits stattgefunden.
Happy Endings: Should We Stay Or Should We Go?
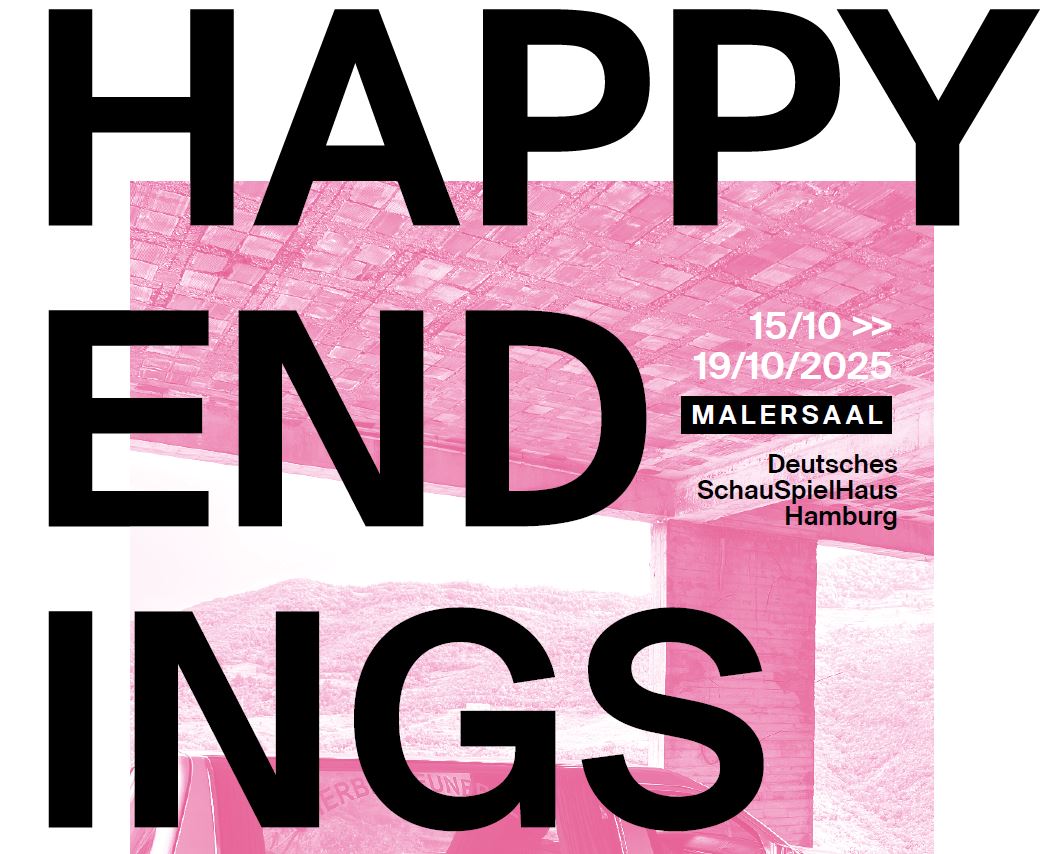
If I go there will be trouble
And if I stay it will be double,
singt die britische Band The Clash in den 1980er-Jahren in ihrem Lied »Should I Stay Or Should I Go«. Was damals die Beschreibung einer offensichtlich eher konflikthaften Liebesbeziehung ist, hat sich heute zu einer zentralen Frage der Menschheit aufgeschwungen. Denn das Verbleiben auf diesem Planeten wird, wie alle Prognosen der Klimaforschung zeigen, in jedem Fall: ein Problem. Wie also weitermachen? Sollten wir den Träumen US-amerikanischer Tech-Milliardäre folgen und den Mars besiedeln? Oder bleiben wir, schauen den aufkommenden Krisen in die Augen und akzeptieren die zu erwartenden Verluste?
Zum Auftakt des Symposiums sind der Soziolo ge Prof. Philipp Staab, die Philosophin Prof. Anna-Verena Nosthoff und der Kultur- und Wirtschaftswissenschaftler Felix Maschewski zu Gast. Nach zwei Lectures führen wir ein Gespräch über die Gestaltbarkeit von Zukunft, den ökologischen Gesellschaftskonflikt, galaktischen Kolonialismus
und natürlich die alles überschattende Frage:
Should we stay or should we go?
Diese Frage stellt auch die anschließende Performance »Terminal«. Die Performerin Lili läuft mit einer exakten
Kopie ihres eigenen Körpers zum Gate. Dort angekommen, fragt sie sich: Worauf warten wir? Auf eine Reise?
Auf eine Evakuierung? Die Autorin Kaija Knauer, die Multimedia-Künstlerin Lili Süper und der Regisseur Ilario
Raschèr haben die Versuchsanordnung »Terminal« für die Eröffnung von »Happy Endings« erarbeitet.
Die Künstlerin Ella Ziegler verbindet in ihrer Praxis performative, partizipatorische und interventionistische
Formate. Für das Symposion hat sie »Das Meer ist so still« entwickelt, eine Station, an der die Besucher*innen
täglich ganz persönliche Trauertücher färben und dabei mit der Künstlerin über ihre Erfahrungen mit Abschied,
Trauer und Tod ins Gespräch kommen können.
Von und mit: Martin Györffy, Kaija Knauer, Felix Maschewski, Prof. Anna-Verena Nosthoff, Ilario Raschèr, Prof. Philipp Staab, Lili Süper, Ella Ziegler
Eine Veranstaltung im Rahmen von „Happy Endings“. Ein Symposium zu palliativer Dramaturgie.
Unsere Lebens- und Wirtschaftsweise stößt an planetare Grenzen. Liebgewonnene Gewissheiten erodieren. Und die Kommunikation hierüber steckt in einem Dilemma: Betonen wir die Fakten zum Stand der Dinge, laufen wir Gefahr, Hoffnungslosigkeit und gesellschaftliche Lähmung zu befeuern. Verlegen wir uns darauf, über die kleinen Schritte in die richtige Richtung zu sprechen, verharmlosen wir die Situation. Beides hilft nicht weiter. Frei nach Heiner Müllers Diktum „Nekrophilie ist Liebe zur Zukunft!“ versucht die palliative Dramaturgie die Zukunft vom Ende her zu denken. Sie übersetzt Erfahrungen aus Sterbebegleitung und Trauerarbeit in gesellschaftliche Erzählungen. Denn nicht nur Individuen, auch Gesellschaften haben ein Verfallsdatum. Doch gibt es einen Zusammenhang zwischen persönlicher Trauer und dem Trauern über den Verlust der Welt? Und wenn ja, wie kommen wir dazu, unsere Situation zu akzeptieren? Schließlich ist gemäß der Palliativmedizin erst in der Phase der Akzeptanz sinnvolles Handeln wieder möglich. Expert*innen der Palliativmedizin, der Soziologie, der Bildungs-und Kulturwissenschaft gehen durch die Korridore unseres Verstandes, konfrontieren uns Künstler*innen mit den Dämonen unserer Verleugnung und Verzweiflung, versöhnen uns Praktiker*innen mit Leben und Tod, um das Ende der Welt (wie wir es kennen) zu einem Anfang zu machen.
Tickets und weitere Infos hier.